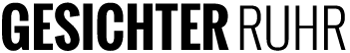Claudia Peppmüller aus Mülheim an der Ruhr
„Mensch Claudia, bei all der Scheiße hast du doch ganz viel Glück gehabt.“
Hallo Claudia. Stell dich doch bitte kurz vor.
Ich bin Claudia Peppmüller, geboren in Essen und ich wohne zurzeit in Mülheim. Ich bin Mitarbeiterin im Friedensdorf International. Seit meinem Anerkennungsjahr 1994 als Diplom-Sozialarbeiterin bin ich mit dem Friedensdorf verbunden.
Hast du Kinder?
Ich habe eine sechzehnjährige Tochter – Mara – die mit in die Arbeit reingewachsen ist. Mir ist Werteerziehung sehr wichtig. Heutzutage neigt man in Deutschland ja dazu, seine Kinder zu sehr zu verwöhnen, so dass sie später ein riesiges Anspruchsdenken haben. Mara ist auf dem Boden geblieben. Sie sieht im Friedensdorf eben auch, dass die Welt da draußen anders tickt. Das ist mir wichtig.
Ist es nicht emotional sehr schwierig, beim Friedensdorf zu arbeiten und die verwundeten Kinder täglich vor Augen zu haben?
Eigentlich nicht. Wenn man von außen kommt, sieht man als Besucher erst mal nur die Verletzungen und Entstellungen der Kinder. Die sind im Gesicht, an den Händen oder an den Füßen sichtbar und das macht einen sehr betroffen. Die Besucher bekommen aber nicht mit, wie großartig die Kinder im Alltag sind. Der ein oder andere, der schon mal einen Rundgang mit uns gemacht hat, sieht, dass die Kinder sehr zuvorkommend und höflich sind und einfach Spaß am Leben haben. Das sind zwei Komponenten, die wir hier im Westen nicht zusammen bekommen: Wie kann man so entstellt sein und trotzdem eine positive Lebenseinstellung haben und diese auch nach außen zeigen? Man kommt mit der Erwartung ins Friedensdorf, dass alle in der Ecke sitzen und weinen müssten, weil Mama und Papa nicht da sind. Die Kinder haben aber einfach ein Riesen-Talent zu sagen „Ich akzeptiere es, wie es ist.“ Sie sind viel pragmatischer.
Und wie macht ihr das mit der Sprache? Es sprechen ja alle eine andere Sprache.
Diesjährig besteht das Friedensdorf 50 Jahre und in der ganzen Zeit wurde bzw. wird mit den Kindern auf Deutsch gesprochen. Die Kinder lernen recht schnell unsere Sprache. Natürlich nicht sofort fließend. In der Regel dauert es ca. drei Monate bis die Kommunikation gegeben ist.
Wir sind zum Beispiel seit dreißig Jahren in Afghanistan und die Kinder, die neu dazukommen, können immer auf Kinder im Friedensdorf zurückgreifen, die übersetzen können. Dadurch kommt es nie zu Sprachschwierigkeiten. Das ist eher so ein „Erwachsenen-Problem“. Kinder sind da sehr flexibel und haben – wie ich es immer scherzhaft sage – ein Gen mehr, nämlich das Sprachgen. Dafür bewundere ich die Kinder.
Haben die Kinder viel Heimweh?
Also, Heimweh ist eine Sache, die immer da ist. Das möchten wir auch nicht unterbinden. Wir wollen, dass die Kinder dieses Gefühl, wieder nach Hause zu wollen, nicht verlieren. Wenn wir wieder kurz vor einem Hilfsflug stehen, kommen immer die Kinder, deren Länder das betrifft, auf mich zu und fragen „Wieviel mal noch schlafen?“ oder „Wann kann ich nach Hause“. Das zeigt, dass sie es nicht verloren haben, endlich wieder zu Mama und Papa zu kommen, was vollkommen normal ist. Ich denke, unser Problem ist immer, dass wir meinen, sie müssen in schicke Häuser auf gepflasterten Straßen wieder ankommen und nicht in Slums zurückdürfen, und das auch noch ihr Zuhause nennen. Die Kinder selber stört es gar nicht. Sie freut es absolut, wieder nach Hause zu ihren Familien zu kommen.
Was ist deine Motivation im Alltag? Was motiviert dich, weiter zu machen?
Erstmals ist der Job schon Motivation genug. Ich sehe die Kinder, den Genesungsprozess und die unbeschreibliche Lebensfreude. Außerdem ich bin einfach von meinem Naturell her ein sehr positiv eingestellter Mensch und auch sehr lebenslustig. Das ist Motivation genug.
Was gefällt dir am Ruhrgebiet?
Also ich finde das Ruhrgebiet großartig. Ich hatte während meines Studiums einen Freund in Bayern, genauer gesagt in München, und ich muss sagen im Gegensatz zu den Ruhrgebietlern war das wirklich ein riesiger Akt, verbindliche Kontakte zu knüpfen. Da muss ich sagen, dass wir Leute aus dem Ruhrpott völlig anders gestrickt sind. Wir sind gerade raus, das finde ich genial.
Außerdem hatte ich noch das Glück, die ersten drei Lebensjahre in einer Bergarbeitersiedlung bei meinen Großeltern leben zu dürfen. Mein Opa war damals in der Zeche Carl in Altenessen tätig. Ich muss sagen, da habe ich gelernt, dass Ruhrgebietler zusammenhalten, respektvoll und solidarisch miteinander sind. Woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann ist, wie aufregend es war, wenn meine Oma und ich meinen Opa von der Arbeit abgeholt haben. Es sah total genial aus, wenn die ganzen Zechenleute, immer noch den Schmutz der Kohle an sich klebend, da rauskamen. Das ließ sie aussehen wie richtige Kerle! Und wenn du dann noch auf die Schulter kamst, warst du der König!
Und wie war deine Kindheit nach diesen drei Jahren?
Meine Oma ist gestorben als ich fast vier Jahre alt war, und ich musste zurück zu meinen Eltern nach Borbeck. Daran kann ich mich noch erinnern, das ging von heute auf morgen. Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich.
Meine Eltern hatten beide ein Alkoholproblem. Das war nicht so lustig. Ich hatte Glück, dass ich über meine damalige Grundschullehrerin – nun meine Adoptivmutter – wieder an das Leben anknüpfen konnte, was ich von meinen Großeltern kannte. Ich durfte jedes Wochenende zu meiner Lehrerin, die mich dann mehr oder weniger mit aufgezogen hat. Ich turnte also immer in zwei Welten rum: Auf der einen Seite gab es Schläge, wir wurden eingesperrt und die Situation war sehr schwierig für mich, auf der anderen Seite lebte ich ein Leben wie es sich kleine Kinder vorstellen. Genau zu meinem 16. Geburtstag bin ich dann freiwillig ins Heim gegangen.
Und was war dann nachdem du mit 16 ins Heim gegangen bist?
Mit 18 bin ich zu meiner Adoptivmutter gezogen und habe da gewohnt, bis ich meinen Ehemann kennengelernt habe. Natürlich wäre ich schon lieber mit 16 Jahren bei ihr gewesen. Leider hatte ich nur die Wahl wieder zu meinen Eltern oder ins Heim zu gehen. Letzteres habe ich dann vorgezogen.
Hast du noch Kontakt zu deinen Eltern?
Nein. Ich habe den Kontakt völlig abgebrochen. Mein Vater ist ein Jahr später nach meinem Weggang verstorben. Auf seiner Beerdigung habe ich meine Mutter zuletzt gesehen. Wie ich kürzlich hörte, leidet sie an dem Korsakov-Syndrom, was sicherlich ihrer Alkoholsucht geschuldet ist.
Meinst du, dass das, was dir in deiner Kindheit passiert ist, dazu geführt hat, dass du beim Friedensdorf gelandet bist?
Sicherlich hat meine Kindheit auch mit der Berufsfindung zu tun. Ich habe sehr viel Hilfe erfahren. Mir war allerdings auch klar, dass man als Sozialarbeiter immer sehr aufpassen muss: Ich bin ganz bewusst nicht in meine Problematik eingestiegen und habe einen anderen beruflichen Schwerpunkt gewählt. Ich wollte nie mit Abhängigen, Alkoholkranken oder Kindern, die geschlagen werden, arbeiten, weil ich glaube, dass ich dafür zu nah dran bin bzw. war. Mein Talent lag immer schon darin, für andere zu organisieren. Durch meinen Ehemann habe ich Kontakt zum Friedensdorf bekommen. In seiner Klinik lagen damals zwei afghanische Kinder, die ich total klasse fand. Natürlich war ich neugierig: Was ist das für eine Organisation? Durch Zufall war dann ja damals noch die Anerkennungsjahrstelle frei.
Du hast Brustkrebs. Wann hast du das erfahren?
Letztes Jahr im Oktober. Ich bin da völlig relaxed in die Untersuchung reingegangen, weil wir über Jahre ein Lipom beobachtet haben, was zwischenzeitlich nicht mehr sichtbar war. Und als ich im Sommer festgestellt habe, dass seitlich im Brustmuskel wieder was ist, habe ich nur gedacht „Och, da ist es wieder“. Ich muss sagen, das war erst mal der totale Schock, als der Arzt schon am Ultraschallbild gesehen hat, dass es böse ist. Da war ich wie vor den Kopf gestoßen. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet, dass das kommt. Man fühlt sich sehr stark auf der sicheren Seite, wenn Brustkrebs nicht in der Familie liegt und man denkt auch, dass man selbst nicht unter den Gefährdeten ist. Ich fand es toll, dass mein Arzt absolut ehrlich war. Das hat mir sehr gut getan. Allerdings war mein erster Gedanke, ob ich den 18. Geburtstag meines Kindes noch miterlebe. Der Arzt hat mich beruhigt und meinte „Jaja, heutzutage sind wir viel weiter, was die Therapien angeht“. Die Tage, bis klar war, um welche Art von Tumor es sich handelt, die fand ich schon schrecklich. Ich war froh, dass es kein aggressiv wachsender oder zerstörerischer Tumor war! Da hab ich dann gedacht: „Mensch Claudia, bei all der Scheiße hast du doch ganz viel Glück gehabt!“
Wo wurdest du operiert?
Im Evangelischen Krankenhaus Oberhausen. Ich musste eine Woche drin bleiben. Man hat mir acht Lymphknoten rausgenommen. Die waren aber alle nicht befallen! Ich habe auch hier Glück gehabt!
Bekommst du Chemotherapie?
Nein. Diese Art von Tumor reagiert wohl nicht auf eine Chemotherapie. Ich bekomme nur Bestrahlung. Die ist zwar auch nicht schön, aber doch eine ganz andere Geschichte, als wenn man seine Haare verliert und der ganze Organismus runtergefahren wird.
Wie schaffst du es, das zu bewältigen?
Durch meine Vergangenheit bin ich ja krisenerprobt. Am wichtigsten ist mir meine Tochter. Wir sind ein spitzen Team! Aber auch die Arbeit im Friedensdorf hilft mir sehr. Ich sehe die Kinder, die um ihr Leben kämpfen oder so schwer verletzt sind und überhaupt nicht aufgeben. Die Kinder geben alles, um ganz schnell auf die Beine zu kommen. Ich habe genau wie die Kinder im Friedensdorf gelernt, auf die Zähne zu beißen und immer wieder nach vorne zu gucken. Der liebe Gott hat mir außerdem noch Humor in die Wiege gelegt. Mit Humor geht das alles auch noch ein Stück besser.
Wenn das Leben ein Comic wäre, welche Figur wärst du dann?
Cap und Capper! Ich finde Geschichten, bei denen es Konflikte gibt, die sich aber am Ende in ein Happy End auflösen, immer ganz toll.

Das Interview führten wir im Februar 2017.
Das Interview bietet einen Einblick in die Gedanken, Meinungen und Perspektiven der interviewten Person zu diesem bestimmten Zeitpunkt, reflektiert aber nicht zwangsläufig ihre gesamte Persönlichkeit oder ihre langfristigen Ansichten. Das Leben verändert sich stetig. Unsere Überzeugungen, Werte und Erfahrungen entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter. Was heute wahr oder relevant ist, kann in der Zukunft anders aussehen. Dieses Interview ist als Momentaufnahme zu verstehen.