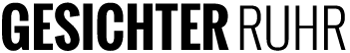Arnulf Vosshagen aus Essen
„Das Tolle am Beruf des Psychologen ist, dass man tief ins Leben anderer Menschen einsteigen kann.“
Hallo Herr Vosshagen, stellen Sie sich bitte kurz vor!
Ich bin Arnulf Vosshagen, promovierter Psychologe. Ein Beruf, den ich sehr geliebt habe und immer noch liebe, denn das ein oder andere mache ich bis heute. Ich bin seit zwei Jahren im Ruhestand und habe die überwiegende Zeit meiner Berufstätigkeit mit Suchtkranken gearbeitet. Das begann eher zufällig, ich habe es über die Jahre aber sehr lieben gelernt.
Was gefiel Ihnen so gut daran?
Man kann eine sehr lange Zeit intensiv mit den Patienten arbeiten. Das Tolle am Beruf des Psychologen ist für mich, dass man tief ins Leben anderer Menschen einsteigen kann und sie sehr persönlich kennenlernt. Es geht vom ersten Gespräch an ans Eingemachte, um Glück oder Unglück, manchmal um Leben und Tod. Es sind immer bedeutsame, gehaltvolle Gespräche, die die Zeit verfliegen lassen. Eine einstündige Sitzung fühlt sich häufig an wie Minuten.
Wollten Sie immer Psychologe werden?
Ich sollte eigentlich das Geschäft meines Vaters übernehmen – ein Stoff- und Textilgeschäft. Ich habe zwar eine Schwester, aber das Geschäft sollte ich, wie das früher eben so war, als Sohn fortführen. Meine Schwester hat das dann hervorragend gemacht. Ich habe damals mit 17 Jahren nach der Handelsschule hier in Essen eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht und währenddessen in einem Studentenwohnheim gewohnt. Dabei wurde mir durch einige Kontakte klar, dass ich studieren wollte. Mein Abitur habe ich dann auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Ich habe zu der Zeit einen Psychologen kennengelernt, so hat sich mein Berufswunsch entwickelt. Ich wollte was Sinnvolles und Gehaltvolles machen, etwas, das Bedeutung hat. Ursprünglich hatte ich an Sozialarbeit gedacht, aber bin dann schließlich bei der Psychologie gelandet. Weil ich glaubte, mich dadurch selbst besser kennenzulernen.
Nach dem Studium haben Sie promoviert.
Ja, das war mir wichtig. In meiner Doktorarbeit ging es um das Thema „Männlichkeit und Abhängigkeit“. 80 Prozent der in Behandlung befindlichen Suchtkranken sind Männer. Das Problem wird aber meistens nicht geschlechtsspezifisch untersucht.
Hat Sie das Thema auch nach Ihrer Promotionszeit noch beschäftigt?
Ja, ich arbeite gerade in einem Praxisprojekt „Männlichkeit und Sucht“ mit. Da geht es um Weiterbildung und Beratung von Therapeuten, damit der männliche Geschlechtsrollenaspekt zukünftig stärker in der Behandlung beachtet wird. Mit Kollegen habe ich dazu ein Handbuch für die geschlechtsspezifische Arbeit mit Männern geschrieben. In der Essener Fachklinik Kamillushaus, wo ich über Jahre leitender Psychologe war, habe ich außerdem ab 1984 eine männersensible Gruppentherapie angeboten. Also reine Männergruppen, in denen es um Männerthemen ging: Sexualität, Freundschaften, Sprache, Gesundheit, Ausdrücken von Gefühlen und so weiter.
Haben Sie einen Fall besonders in Erinnerung?
Durchaus viele, aber alle waren besonders, weil ich – wie die Menschen das auch erwarten können – auf jeden zunächst so eingegangen bin, wie er war. Wenn man jemand nah kennenlernt, entwickelt sich fast immer eine besondere Beziehung.
Hat sich mal eine Freundschaft entwickelt?
Grundsätzlich sollte man das von dieser therapeutischen Beziehung klar trennen. Das hat schon Freud angestoßen: Man sollte abstinent sein – das heißt, die Probleme des Patienten stehen im Mittelpunkt. Ich erzähle zwar auch etwas von mir, aber nur, wenn ich glaube, dass das für die Therapie Sinn macht, und nichts über Dinge, in denen ich noch irgendwie drin stecke.
Ist Ihnen das immer leicht gefallen?
Das gehört zur Professionalität einfach dazu. Es gibt aber einen einzigen Patienten, mit dem mich viel verbindet, den ich duze und den ich ab und zu zum Essen treffe und der auch über mich einiges weiß. Er war befreundet mit einem anderen Patienten aus meiner Anfangszeit im Kamillushaus. Dieser war über eine lange Zeit sehr krank und wir haben uns um ihn gemeinsam gekümmert, als er schwer krebskrank war. Für den erkrankten Patienten war klar, dass er mit dem Trinken nicht wieder anfangen würde, obwohl das in dieser Situation wohl jeder verstanden hätte. Dieser bat mich, seine Grabrede zu halten, was ich auch getan habe. Diese Erfahrung mit Krankheit und Tod verbindet mich mit meinem befreundeten Patienten bis heute sehr.
Trinken Sie selbst Alkohol? Ist es Ihnen unangenehm, wenn ein Patient Sie zum Beispiel beim Essen mit einem Glas Wein sieht?
Ja, ich trinke Alkohol, und nein, richtig unangenehm ist mir das nicht. Ich denke, das ist etwas, womit derjenige umgehen können muss. Weil ja auch andere aus seiner Familie oder der Partner gelegentlich trinken. Diejenigen, die trocken geworden sind, müssen damit leben, dass sie in einer Gesellschaft leben, die nun mal alkoholisiert ist. Gerade in der Zeit des Entzugs sehen diese Menschen sofort jeden, der trinkt. Alle werden wahrgenommen – ob in der Straßenbahn oder jemand, der mit einer Flasche Bier über die Straße läuft. Ein Patient sagte mir mal, dass er immer sofort weiß, wo sich in einem Restaurant der Alkohol befindet. Damit gilt es zu leben und sich eine klare Antwort auf diese Reize zu geben.
Trotz Ruhestand arbeiten Sie manchmal noch – zum Beispiel an dem Praxisprojekt „Männlichkeit und Sucht“. Woran noch?
Ich gebe Seminare über Wohlbefinden und Abstinenz, weil ich finde, dass das zusammen gehört. Es geht nicht nur darum, trocken zu sein, sondern darüber hinaus das Leben in seiner Tiefe und Schönheit mit Achtsamkeit und Optimismus zu leben. Menschen, die etwas sehr Schlimmes erlebt haben, lernen oft, umzudenken und das Leben neu zu sehen. Sie können lernen, sich über kleine Momente zu freuen, sich sehr genau und bewusst zu entscheiden und oft auch über sich hinauszuwachsen. Ich denke, gerade nach einer Sucht ist es gut, sich mit sich selbst und seinen Zielen auseinanderzusetzen und bewusster zu leben.
Diese Fragen beschäftigen sehr viele Menschen – auch ohne schlimme Suchtgeschichte.
Ich schreibe im Moment auch an einem Buch über dieses Thema. Momente genießen, um für die langfristige Zufriedenheit etwas zu tun. Manchmal ist einfach zu viel im Kopf, was ablenkt, um den Moment oder zum Beispiel tolle Naturereignisse genießen zu können. Ich möchte vermitteln, wie man langfristige Zufriedenheit erreichen kann. Es ist ein toller Weg, für sich selbst herauszufinden, was einen glücklich macht – anstelle von Drogen oder Alkohol. Es ist wichtig, stärker in der Gegenwart zu leben und Momente auszukosten. Beziehungen, Liebe spielen da eine große Rolle. Das müssen nicht unbedingt nur romantische Beziehungen sein. Familie, Freunde – das alles ist wichtig und gibt einem viel zurück.
Glauben Sie, es gibt etwas, das jedem Menschen in schwierigen Zeiten helfen kann?
Eine optimistische Einstellung hilft schon sehr. Es gab mal eine Untersuchung anhand von Dokumenten und Notizen beim Ordenseintritt von Nonnen, die etwa 1920 ins Kloster gegangen sind. Psychologen habe viel später die Aufzeichnungen analysiert, die die Nonnen als Bewerbung geschrieben hatten, um ins Kloster einzutreten und geschaut, wie viele positive Aussagen da drin sind – sowas wie „Das Leben ist häufig schön“ oder „Ich bin überwiegend optimistisch“. Und diejenigen, die dort überwiegend positive Dinge geäußert haben, haben tatsächlich zehn Jahre länger gelebt und waren deutlich zufriedener.
Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich komme ursprünglich aus Olpe im Sauerland, was ich damals als sehr eng und katholisch empfunden habe – der liebe Gott wusste alles und die Nachbarn wussten alles noch genauer. Ich habe dort gelebt, bis ich 14 war. Wenn ich dort mal mit einem Mädchen durch die Stadt gelaufen bin, wussten meine Eltern das schon, bevor ich überhaupt zu Hause war. Das fand ich schrecklich.
Wann kamen Sie ins Ruhrgebiet?
Mit 17 habe ich meine Lehre im Kaufhaus Cramer & Meermann in Essen begonnen. Das war 1968. Von da an habe ich das Ruhrgebiet kennen und lieben gelernt und die Anonymität der Großstadt sehr genossen.
Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung?
Durch das Wohnen im Studentenwohnheim habe ich viele junge Menschen kennengelernt und konnte tun, was ich wollte. Es war eine sehr besondere Zeit, es gab viele Festivals in Essen und Konzerte in der Grugahalle. Auch die Essener Songtage, unter anderem mit Frank Zappa – das alles war eine ganz andere Welt für mich. Das war so eine Zeit des Aufbruchs. Bei den Essener Songtagen lagen wunderschöne langhaarige Frauen mit ebenso langhaarigen Männern auf dem Boden und rauchten Joints, den Kopf auf der deutschen Ausgabe der Prawda, dem russischen Zentralorgan. Eine neue Zeit brach an.
Liebe und Frieden, also ganz die Sechziger?
Eine Zeit des Aufbruchs und der Befreiung, die ich genossen habe, und die den Kleinbürgermief weggeweht hat.
Wie kommt es, dass Sie auch jetzt wieder in Essen leben?
Meine Frau ist in Essen-Rüttenscheid geboren. Und für mich war die Stadt auch vertraut und ich mochte die Gegend sehr. So ist die Entscheidung auf Essen gefallen. Davor habe ich in Tübingen studiert und im Westerwald in Kliniken gearbeitet.
Wie sehen Sie die Stadt heute?
Ich finde es schön, mit der U-Bahn in die Stadt zu fahren. Ich vermisse das ländliche Sauerland überhaupt nicht. Ich kann hier in den Stadtwald oder die Gruga gehen. Das liebe ich sehr – die Abwechslung zwischen dem Grünen hier und dem Multikulturellen, wenn man mit der Straßenbahn Richtung Gelsenkirchen fährt. Das gehört eben einfach dazu. Tübingen war eine Art Idylle – hier ist es das reale und bunte Leben, eine schöne Mischung. Menschen, die sehr offen sind und sehr interessant. Mit den Kindern waren wir früher fast täglich im Grugapark. Und man hat den Vorteil, mit der S-Bahn zu Konzerten nach Köln oder Düsseldorf fahren zu können.
Was macht Sie glücklich?
Ich bin sehr stolz auf meine beiden erwachsenen Kinder und liebe sie sehr. Mein Sohn lebt in Freiburg und macht seine Facharztausbildung. Meine Tochter wohnt in Berlin und ist Diplom-Psychologin. Und ich habe das Glück – was ja auch nicht jeder hat – eine Frau gefunden zu haben, die ich immer noch sehr schätze und bewundere. Sie ist nach über dreißig Jahren immer noch die tollste Frau für mich.
Wovor haben Sie Angst?
Wenn ich in meinem Umfeld so erlebe, dass Menschen sterben, wird mir bewusst, dass ein Partner immer früher stirbt als der andere. Dass meine Frau nicht mehr da ist, ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte. Das wäre eine Situation, mit der ich nur sehr schwer fertig werden würde.
Reisen Sie gerne?
Seitdem die Kinder aus dem Haus sind, reisen meine Frau und ich viel. In Malaysia waren wir mitten im Urwald, wo die Bäume endlos sind und der Himmel nicht zu sehen. Da herrschte ein unglaublicher Krach – die Natur ist dort unglaublich zu Gange. Das war beeindruckend. Vietnam und Indonesien haben mir auch sehr gefallen. Auf Sulawesi, einer Insel in Indonesien, waren wir in einer Unterkunft, die von einer deutschen Ethnologin und ihrer indischen Freundin betrieben wurde. Da gab es kein fließendes Wasser und nur morgens und abends eine Stunde Strom. Ich finde es schön, andere Lebenswelten kennenzulernen, zum Beispiel auch in Japan oder Ghana. Demnächst möchten wir gerne nochmal nach Afrika.
Wenn das Leben ein Comic wäre, welchen Figur wären Sie dann und warum?
In meinem Kinderzimmer hatte ich immer ein Poster von Charlie Brown. Mit ihm konnte ich mich mit 13, 14 Jahren gut identifizieren – eine Zeit, in der man selbst unsicher, ratlos und suchend ist. Und heute guckt man eben, dass nicht alle so sehr merken, dass man eigentlich Charlie Brown ist.

Das Interview führten wir im Dezember 2018.
Das Interview bietet einen Einblick in die Gedanken, Meinungen und Perspektiven der interviewten Person zu diesem bestimmten Zeitpunkt, reflektiert aber nicht zwangsläufig ihre gesamte Persönlichkeit oder ihre langfristigen Ansichten. Das Leben verändert sich stetig. Unsere Überzeugungen, Werte und Erfahrungen entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter. Was heute wahr oder relevant ist, kann in der Zukunft anders aussehen. Dieses Interview ist als Momentaufnahme zu verstehen.