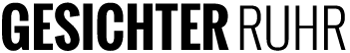Schwester Regina Greefrath aus Essen
„Bei Turbulenzen im Flugzeug gibt es keine Atheisten.“
Hallo Schwester Regina. Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Ich bin Schwester Regina, bin jetzt 33 Jahre alt und gehöre zur Gemeinschaft der Augustiner Chorfrauen in Essen. Früher habe ich als Schülerin das BMV-Gymnasium in Essen besucht. Nach dem Abitur habe ich in Münster Spanisch und Religion auf Lehramt studiert. Ich habe ein Jahr in Madrid gelebt und bin anschließend den Jakobsweg gelaufen, weil ich noch Zeit hatte, bis das Studium im Münster wieder losging.
2009 bin ich als Postulantin ins Kloster eingetreten, habe dann die Ordensausbildung gemacht und nach der zeitlichen Profess 2011 mein Referendariat in Paderborn absolviert.
Mittlerweile arbeite ich seit 2013 als Lehrerin am BMV-Gymnasium und unterrichte Spanisch und Religion.
War das der Plan, wieder zur BMV zurückzukommen?
Das ergab sich mit dem Klostereintritt. Ich hatte das nicht von Anfang an vor. Wenn man mir in meiner Schulzeit gesagt hätte, dass ich irgendwann mal ins Kloster gehen würde, hätte ich gesagt, dass mich dort keine zehn Pferde hinbekämen, aber es ist dann eben doch so gekommen.
Die BMV war ja früher ein reines Mädchengymnasium und ist jetzt gemischt. Was hat sich verändert?
Die Jungs peppen den Unterricht mit ihren Sprüchen schon sehr auf und sie sind wilder als die Mädchen. Durchgebrochene Tische hatten wir früher nicht so oft … Die ersten Jungen, die auf die BMV kamen, haben sich geärgert, wenn die Oberstufenschülerinnen sagten „Oh wie süß – die kleinen Jungs!“. Aber das hat sich jetzt alles gelegt. Die Schüler, die jetzt anfangen, haben ja schon vier Stufen über sich, in denen die Klassen gemischt sind. Die ersten Jungs, die auf die Schule kamen, waren natürlich mutig, aber sie waren auch stolz darauf. Heute machen die Jungen ungefähr ein Drittel pro Jahrgang aus.
War Religion in Ihrem Leben immer schon ein wichtiges Thema?
Ich habe die klassische katholische Karriere gemacht: Ich war Messdienerin, war in Jugendgruppen aktiv, habe auch Gruppen geleitet und ich besuchte Gottesdienste. Damals hatte ich aber auch mal eine Trotzphase, als ich merkte, dass aus meiner Klasse keiner in die Kirche ging. Zu dieser Zeit hatte ich dann jeden Sonntag Diskussionen mit meinen Eltern darüber, ob ich die Kirche besuchen müsste oder nicht. Dabei habe ich mich in der Kirche wirklich wohlgefühlt. Es war nur dieses: „Die anderen gehen auch alle nicht!“
Als irgendwann der Brief vom Bistum kam, ob ich mich firmen lassen möchte, habe ich mich dazu entschlossen: und zwar nicht der Geschenke wegen, sondern wegen meines Glaubens, zu dem ich noch einmal neu und bewusst Ja sagen wollte. In der Firmvorbereitung habe ich gemerkt, dass auch andere Jugendliche die gleichen Fragen und auch Zweifel hatten wie ich. Die Gespräche mit ihnen haben mir damals sehr geholfen.
Besonders eine Fahrt nach Taizé Ostern 2001 war eine sehr prägende Erfahrung für mich. Dort spürte ich, dass der Glaube an Gott verbindet und Gemeinschaft stiftet – über Ländergrenzen hinweg.
Wie kam es zu dem Eintritt ins Kloster?
Kurz vor meinem Abitur habe ich erste Kontakte zum Kloster geknüpft. Die Schwestern hatten zu einer sogenannten „Ora et labora“-Woche eingeladen. Man konnte als Schülerin eine Woche mit den Schwestern im Kloster leben und sich anschauen, wie dort der Tagesablauf ist. Dieses Angebot gibt es übrigens heute immer noch. Das hat mich interessiert. Die Schülerinnen nehmen am Chorgebet mit den Schwestern teil, gehen dann normal zur Schule und nachmittags wird ein bisschen Programm angeboten und wir hatten viel Austausch in der Gruppe. Ich fand diesen strukturierten Tagesablauf für mich sehr spannend. Vor allem war es interessant, mal „hinter die Kulissen“ zu schauen. Man sieht die Schwestern ja den ganzen Tag in der Schule, aber was sie vorher und nachher machen, bleibt den Schülerinnen verborgen. Ich konnte sehr gut nachvollziehen, dass manche Menschen so leben wollen, aber für mich kam das damals noch nicht infrage. Ich wollte eigentlich irgendwann heiraten, eine Familie gründen und einen Hund haben.
Dann habe ich 2003 mit dem Studium in Münster begonnen, habe mich aber immer in den Semesterferien – wenn ich Hausarbeiten schreiben oder für Prüfungen lernen musste – zum Arbeiten ins Kloster zurückgezogen. Da gab es kein Internet und kein Fernsehen, also keine Ablenkung, und ich bin früh aufgestanden …
Die Chorgebetszeiten haben sich wie ein roter Faden durch den Alltag gezogen, ich musste nicht selbst kochen und die Schwestern haben mich abgefragt oder mal ein Kapitel von einer Hausarbeit korrekturgelesen. Den Wechsel von Arbeit, Freizeit, Gemeinschaft und Gebet habe ich sehr genossen und es hat mir sehr gut getan.
Und als eine von den älteren Schwestern mich fragte „Wann trittst du denn eigentlich hier ein?“ bin ich ans Nachdenken gekommen. Die Frage nach der eigenen Berufung hat sich auch immer mehr in den Prüfungsstoff meines Studiums gemischt. Als ich dann 2007 auf dem Jakobsweg gewandert bin, hatte ich Zeit, mein eigenes Leben zu reflektieren. Man läuft 750 Kilometer durch die Pampa und sieht kaum einen Menschen. Da wird das Herz weit und man wird empfänglicher für die Stimme Gottes, die im Alltagslärm oft untergeht. Da habe ich für mich den Entschluss gefasst, mir das Leben im Kloster genauer anzuschauen und es zu versuchen. Man kann nach dem Eintritt erstmal einige Jahre ausprobieren, ob das Klosterleben eine passende Lebensform ist, bevor man sich dann durch die Gelübde auf Lebenszeit an den Konvent bindet.
Wie lange war die Entscheidungsfindung, ob Sie ins Kloster eintreten?
Das war ein Zeitraum von circa fünf Jahren: vom ersten Nachdenken bis zu meinem Entschluss. Ich habe mir das sehr gut überlegt und es war mir wichtig, erst das Studium abzuschließen. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, ob ich zum Beispiel nur ins Kloster gehen will, weil ich die Schwestern der BMV so ins Herz geschlossen habe. Das ist natürlich der falsche Weg. Es geht ja primär um meinen Glauben an Gott und meine Berufung und nicht darum, mir Menschen auszusuchen, mit denen ich zusammen leben möchte.
Haben Ihre Eltern die Wahl, ins Kloster einzutreten, beeinflusst?
Schon, aber eher indirekt. Sie haben mich katholisch erzogen, ich bin in einen katholischen Kindergarten, auf eine katholische Grundschule und ein katholisches Gymnasium gegangen. Mit meinen Eltern bin ich jeden Sonntag in die Kirche gegangen – auch in meiner Trotzphase. Auch Tisch- und Abendgebete gehörten selbstverständlich dazu.
Ich habe mich allerdings selbst für das BMV-Gymnasium entschieden, auch wenn mein Schulweg dadurch 15 Minuten länger war, als zum nächstgelegenen Gymnasium in Essen-Rüttenscheid. Meine Freundinnen und Cousinen sind aber zur BMV gegangen. Meine Eltern hätten nicht gedacht, dass ich das durchhalte, aber da war ich ein kleiner Sturkopf und habe den längeren Schulweg die ganze Schulzeit auf mich genommen.
Wie haben denn Ihre Eltern reagiert als Sie in das Kloster eingetreten sind?
Meine Eltern waren von meiner Entscheidung ins Kloster zu gehen zuerst nicht so begeistert. Ich bin das einzige Kind – das heißt also: keine Enkelkinder. Aber so langsam finden sie sich damit ab. Meine Mutter sagt, wenn ich das Gefühl habe, dass das mein Weg ist, dann muss ich damit glücklich werden.
Und wie haben Freunde auf Ihren Entschluss reagiert?
Unterschiedlich. In Münster kenne ich ziemlich viele Theologen – die haben schon mehr Verständnis für einen solchen Schritt. Aber ich habe auch Leute im Freundeskreis, die mit Kirche gar nichts am Hut haben. Für die war meine Entscheidung so wie „Ich geh freiwillig ins Gefängnis“. Die haben teilweise ein ziemlich antiquiertes Bild vom Klosterleben, haben vielleicht mal den Film „Geschichte einer Nonne“ gesehen und meinen dann zu wissen, wie das Klosterleben aussieht. Der Film spielt in den 30-er Jahren und da war ja auch vieles noch anders.
Und heute ist alles moderner?
Natürlich! Die Schüler machen zum Beispiel immer große Augen, wenn ich sage, dass ich auch WhatsApp nutze. Natürlich leben wir in Armut und verzichten so gut es geht auf Überflüssiges. Gütergemeinschaft ist ein wichtiges Stichwort, das heißt, dass allen alles gehört. Natürlich hat die einzelne Schwester auch privaten Besitz. Was wir nötig für unser Leben brauchen, sollen wir auch haben. Ich habe zum Beispiel einen Laptop und nutze das Internet, um meinen Unterricht vorzubereiten. Unser Ordensgründer, der hl. Pierre Fourier, hat mal gesagt, unser Unterricht soll auf der Höhe der Zeit sein. Und da muss man auch mit der Zeit gehen. Ich kann ja nicht Unterricht wie vor 50 Jahren machen.
Haben Sie sich auch mal andere Klöster angesehen?
Ich habe mir vor allem kontemplative Klöster angeschaut, die eine zurückgezogenere Lebensweise haben und war zu Gast bei Benediktinerinnen, Karmelitinnen und Klarissen.
Fasziniert haben mich vor allem die Länge und die Intensität der stillen Gebetszeiten: zweimal am Tag eine ganze Stunde stille Anbetung mit der ganzen Gemeinschaft. Am Anfang fand ich diese Stunde schrecklich lang, habe ständig auf die Uhr geschaut und mich gefragt „Wann ist die Stunde endlich um?“. Aber nach ein, zwei Wochen war ich drin. Man kann die Stunde „überstehen“ – mit den Gedanken, die dann kommen – und die Stille kommt bei einem an, bis man selber ruhig wird.
Diese zurückgezogene Lebensweise ist für zwei, drei Wochen sehr schön, um zur Ruhe zu kommen und eine intensivere Beziehung zu Gott zu pflegen, aber dauerhaft hätte ich mir das für mich nicht vorstellen können. Ich brauche schon den Kontakt zu den Menschen.
Und was gefällt Ihnen bei den Augustiner Chorfrauen?
An unserer Lebensweise als Augustiner Chorfrauen finde ich so schön, dass es ein Mix aus aktivem und kontemplativem Klosterleben ist – „Vita Mixta“ sagt man dazu. Wir haben die Schule und dadurch den Kontakt zur Welt, aber wir haben eben auch den Lebensraum im Kloster, die Klausur, die nur den Schwestern zugänglich ist. Dahin können wir uns zurückziehen. Darüber hinaus beten wir das volle Stundengebet, das heißt, wir beten über den Tag verteilt alle Gebetszeiten (Laudes, Terz, Lesehore, Vesper, Komplet). Unsere Ordenskleidung drückt aus, was wir leben. Die meisten Menschen begegnen mir sehr freundlich, wenn sie mich in Ordenskleidung sehen. Sie wissen direkt, was ich für eine bin, wenn ich vor ihnen stehe.
Tragen Sie Ihre Ordenskleidung jeden Tag?
In der Regel ja – aber es gibt natürlich Situationen, in denen sie eher stört… wie zum Beispiel beim Bergsteigen im Urlaub, wenn man einen Klettergurt tragen muss. Aber sonst ist das eben unsere Ordenskleidung, die uns als Schwestern sichtbar macht, die wir auch gerne tragen. Man kann sogar damit Fußballspielen oder Fahrradfahren. Das ist kein Problem.
Ist Regina auch vor dem Ordenseintritt Ihr Name gewesen?
Ja. Regina ist mein Taufname. Man kann bei der Einkleidung selber entscheiden, ob man einen anderen Namen wählt, oder seinen eigenen behält. Ich habe mit Rücksicht auf meine Eltern meinen Taufnamen behalten, denn sie haben mir diesen ja gegeben. Und es gab im Kloster keine andere Schwester mit diesem Namen. Früher fand ich ihn ganz, ganz schrecklich, aber ich habe mich damit abgefunden. Der Name gehört zu mir wie meine Haare und meine Sommersprossen und ich hätte es auch sehr komisch gefunden, mir selber einen anderen Namen zu geben. Ich hätte mich gar nicht entscheiden können.
Hatten Sie damals einen Partner als Sie sich entschieden haben, Nonne zu werden? Gab es da einen Konflikt?
Nein, nicht zu dem Zeitpunkt, als ich mich für dieses Leben entschieden habe. Da musste ich niemanden wegschicken. Das wäre mir auch schwergefallen, jemandem klarzumachen, aus welchem Grund man die Beziehung beenden muss: den Partner mit einem anderen Partner zu tauschen, den man nicht sieht. Das ist bestimmt nicht für jeden leicht nachzuvollziehen.
Wie viele Schwestern leben im Kloster mit Ihnen zusammen?
Im Moment sind wir 13 Schwestern, davon eine Novizin, also eine Schwester in der Ausbildung. Unsere älteren Schwestern können sich noch an eine Zeit erinnern, in der 72 Schwestern dort gewohnt haben. Die Hälfte der Schwestern ist über 80 Jahre alt. Die älteren Schwestern nehmen sehr lebendig Anteil daran, was wir Jüngeren für verrückte Sachen machen.
Warum gibt es heute so wenige Frauen, die ins Kloster gehen?
Früher gab es für die Menschen weniger Alternativen für ihre Lebensgestaltung als es heute der Fall ist. Auch waren Eltern stolz darauf, wenn eine Tochter ins Kloster ging oder ein Sohn Priester wurde. Aber heutzutage spielt die Kirche nicht mehr so eine große Rolle im Leben der Menschen. Heute sind die Menschen viel individualisierter, von allen Seiten wird Flexibilität gefordert. Manche haben Bindungsängste. Dazu kommt noch, dass man viele Berufe heute ausüben kann, ohne ins Kloster gehen oder zölibatär leben zu müssen, beispielsweise Lehrerin.
Die Schwestern, die vor 50 Jahren ins Kloster gegangen sind, hatten gar nicht die Zweifel, die ich hatte, als ich mich dazu entschieden habe. Die hatten andere Schwierigkeiten. Sie wussten zum Beispiel, dass sie, wenn sie ins Kloster gehen, nicht zur Beerdigung der Eltern gehen konnten, weil die Klausur früher strenger war und sie dann ohne weiteres das Haus nicht verlassen konnten. Das wussten sie aber vorher. Heute ist vieles anders, wir können natürlich rausgehen. Aber das Gemeinschafts- und Gebetsleben sollte nicht darunter leiden.
In Essen gibt es zum Beispiel auch Gemeinschaften, die bewusst keinen Nachwuchs mehr aufnehmen. Es ist ja für jüngere Frauen und Männer auch eine drängende Frage, wenn die Mitschwestern oder –brüder so viel älter sind: „Was wird aus mir, wenn alle weg sind?“.
Die Schüler fragen manchmal schon „Was ist denn, wenn irgendwann mal keine Schwester mehr da ist?“ – und sind wirklich betroffen und können sich die BMV ohne Schwestern nicht vorstellen. Ich würde das jetzt nicht kampflos alles ins Leere laufen lassen, aber dass jemand ins Kloster eintreten will, das kann man ja nicht „machen“. Gott ist es, der beruft. Und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er auf diesen Ruf antworten möchte. Wir können aber neu und anders auf unsere Lebensform aufmerksam machen, quasi werben. Ordensleben lohnt sich!
Alleine das Gemeinschaftsleben ist ja schon eine Herausforderung. 13 Frauen auf einem Haufen – 13 verschiedene Charaktere, 13 verschiedene Lebensgeschichten … davon lebt letztendlich die Gemeinschaft. Jede bringt ihre Talente so ein, dass alle etwas davon haben.
Werbung und Kirche? Wie funktioniert das?
Da spielt das Internet eine ganz große Rolle. Wir haben zum Beispiel seit ein paar Jahren eine Facebook-Seite, die inzwischen mit Instagram verknüpft ist, und eine neue Homepage gestaltet. Wenn du heutzutage nicht online bist, existierst du nicht. Die jungen Leute von heute gehen nicht zu ihrem Pfarrer und fragen, ob er nicht ein schönes Kloster kennen würde, die googlen! Wir müssen da zu finden sein, wo die jungen Menschen uns suchen. Und natürlich nicht nur im Internet. Schon die Apostel sind da hingegangen, wo die Menschen waren, und haben die frohe Botschaft verkündet. Wir können nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen.
Haben Sie auch Hobbies, die nichts mit der Kirche zu tun haben?
Bergsteigen fällt mir da spontan ein. Im Urlaub fahre ich gerne in die Alpen. Ansonsten lese ich gerne und bin gern im Garten. Würde auch gerne mehr Gitarre spielen, aber das geht im Alltag oft unter.
Wie kommt das Imageproblem der Kirche Ihrer Meinung nach zustande?
Ich glaube, dass das in jüngster Zeit ganz eng mit dem Missbrauchsskandal verknüpft ist. Das ist natürlich ein schlimmes Vergehen, das man in keinster Weise schönreden darf. Allerdings sind auch andere Berufsgruppen davon betroffen. Nur ist es bei Priestern besonders schlimm, weil es genau die Berufsgruppe ist, in der man das so gar nicht mit dem Lebensstil und mit dem christlichen Menschenbild vereinbaren kann. Die Kirche ist aber, so sagte mir jemand, einer der wenigen Arbeitgeber, der diese Fälle heute systematisch aufarbeitet und sein Personal jetzt zu umfassenden Präventionsschulungen schickt. Wir haben auch mit dem gesamten Kollegium der Schule eine zweitägige Missbrauchspräventionsschulung gemacht. Und jeder, der länger als sechs Wochen an der Schule oder anderen kirchlichen Einrichtungen arbeitet, muss ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.
Ich habe häufig den Eindruck, dass bei dem Gedanken an die Kirche in den Köpfen vorrangig die Themen Kirchensteuer, kein Sex vor der Ehe, Zölibat, alte Leute, verstaubte Bänke, etc. auftauchen – das wird der Kirche auch nicht immer gerecht. Die Kirche wird bei vielen Menschen immer erst dann wichtig, wenn etwas Schlimmes passiert. Wie sagt man so schön: „Bei Turbulenzen im Flugzeug gibt es keine Atheisten“.
Dabei hat die Kirche den Menschen so viel zu bieten: Sie verkündet die frohe Botschaft, sie stiftet Gemeinschaft, sie nimmt sich der Sorgen und Nöte der Menschen an, sie bietet Unterstützung, sie gibt Rat … wenn man alle kirchlichen Einrichtungen und Dienstleistungen aus unserem Alltag streichen würde, wäre die Welt ein ganzes Stück ärmer.
Ist Ihnen mal was Verrücktes, Spannendes oder Besonderes in Ihrem Leben passiert?
Verrückt war mal etwas, was mir auf dem Jakobsweg passiert ist. Ich hatte eine Frau – eine Grundschullehrerin aus Hessen – kennengelernt und wir sind zusammen gelaufen. Als wir an einem Tag aus León herausliefen, hatte sie Probleme mit ihrem Rücken. Ihr Rucksack saß nicht richtig. Dann sind wir in einem kleinen Kaff etwa zehn Kilometer von León entfernt angekommen – dort gab es gefühlt drei Einwohner und 15 Schafe. Wir haben uns an eine Bushaltestelle gesetzt und wollten Pause machen. Meine Begleiterin sagte halb im Spaß „Ach, wenn jetzt ein Bus nach Santiago fahren würde, ich würd sogar einsteigen.“. Wir saßen also da und aßen etwas und sie fügte hinzu: „Jetzt mal so eine Etappe ohne den schweren Rucksack laufen – das wär was.“ Aber den Rucksack muss man eben mitschleppen. Auf einmal fuhr ein Auto mit einem deutschen Kennzeichen vor, hielt an und der Fahrer stieg aus. Es stellte sich heraus, dass die beiden aus dem Auto – ein deutsches Ehepaar – den gleichen Weg hatten wie wir. Meine Begleiterin bekam ganz große Augen. Die Frau war schwer an Krebs erkrankt und ihr Mann wollte ihr den Wunsch erfüllen, noch einmal den Jakobsweg zu laufen. Sie konnte nur eben nicht die gesamte Strecke laufen, sondern nur leichte Strecken, und er transportierte das Gepäck und war mit dem Auto in etwa in ihrer Nähe. An diesem Tag wollte sie von der Bushaltestelle bis zu dem Ort laufen, den wir auch als Tagesziel festgelegt hatten. Also entschieden wir, zusammen zu laufen. Und der Mann sprach dann die lang ersehnte Frage aus, ob er unsere Rucksäcke ins Auto packen sollte. So ist der Wunsch meiner Begleiterin in Erfüllung gegangen und sie konnte eine Etappe ohne Rucksack laufen. Es war herrlich!
Was gefällt Ihnen am Ruhrgebiet?
Essen ist meine Heimatstadt. Ich bin ein echtes Pottkind. Wenn ich einen rauchenden Schlot sehe oder die Fördertürme und Zechen, dann schlägt mein Herz schon höher. Und ich liebe es, auf die Halden zu steigen. Wenn man ganz oben ist, sieht man, wie grün das Ruhrgebiet ist. Viele Leute haben das Vorurteil, dass hier alles grau wäre. Ich liebe auch die A40 – obwohl da immer Stau ist. Und unseren Dialekt! Hömma! Ab und zu liest eine Mitschwester uns Geschichten auf ruhrdeutsch vor, wie „Kumpel Anton“ oder „Max und Moritz im Kohlenpott“. Auch die Menschen hier sind etwas Besonderes: so offen und tolerant – echte Ruhris eben. Es ist ja auch ein richtiges Multi-Kulti-Gebiet hier.
Wenn das Leben ein Comic wäre, welche Comicfigur wären Sie und warum?
Ich mag die Peanuts sehr gerne. Ich glaube, ich wäre Snoopy … der auf seiner Hütte liegt und in den Himmel guckt.

Das Interview führten wir im August 2017.
Das Interview bietet einen Einblick in die Gedanken, Meinungen und Perspektiven der interviewten Person zu diesem bestimmten Zeitpunkt, reflektiert aber nicht zwangsläufig ihre gesamte Persönlichkeit oder ihre langfristigen Ansichten. Das Leben verändert sich stetig. Unsere Überzeugungen, Werte und Erfahrungen entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter. Was heute wahr oder relevant ist, kann in der Zukunft anders aussehen. Dieses Interview ist als Momentaufnahme zu verstehen.