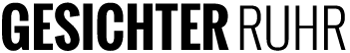Jochen Werner aus Essen
„Das Smart Hospital bietet bessere Medizin, es rückt Patienten und Mitarbeiter in den Mittelpunkt.“
Hallo Herr Prof. Dr. Werner. Stellen Sie sich bitte kurz vor.
Mein Name ist Jochen Werner, ich bin 59 Jahre alt und komme aus Flensburg in Norddeutschland. Meine Mutter ist Dänin, mein Vater aus Hamburg, also bin ich ein richtig norddeutsches Gewächs.
Ich habe in Kiel Medizin studiert und bin dann von da ins hessische Marburg übergesiedelt. Dort habe ich lange Zeit als Chef der Hals-Nasen-Ohren-Klinik gearbeitet. Meine Schwerpunkte waren Krebsbehandlungen in den Bereichen Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf. Als ich die Klinik mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut aufgebaut hatte, wurde ich gefragt, ob ich mich nicht mehr fürs Ganze engagieren möchte. So wurde ich Ärztlicher Direktor in Marburg und darauf Ärztlicher Geschäftsführer in Gießen und Marburg – das ist die drittgrößte Uni-Klinik in Deutschland.
Ich hatte also immer mehr mit dem Krankenhausmanagement zu tun und verlor etwas den Kontakt zu den Patienten. Das ist auf der einen Seite nicht schön, weil man das ja eine lange Zeit sehr gern gemacht hat, aber auf der anderen Seite kann man natürlich im Klinikumsvorstand auch vieles bewegen, was im Endeffekt wiederum den Patienten hilft.
2015 kam die Anfrage, ob ich nach Essen wechseln möchte. Das haben wir in der Familie besprochen. Es war ein ganz kurzes Gespräch, weil Heike, meine Frau, gleich sagte „Machen wir! Wir gehen nach Essen ins Ruhrgebiet.“ Und so sind wir, ohne eine Kenntnis darüber zu haben, wie es hier wirklich ist, umgezogen. Ich muss sagen, wir fühlen uns hier total wohl. In Essen kann ich vieles gestalten, wir sind gut angekommen, die Leute sind toll, die Klinik ist hervorragend.
Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Wollten Sie das schon immer machen?
Ich wollte Arzt werden, seitdem ich zehn bin. Ab da war der feste Wunsch da. Und den habe ich auch nie ganz aus den Augen verloren. Es gab zwischenzeitlich mal eine kurze Fußball-Phase, wo ich dachte, irgendwie könnte da mehr hinter stecken. Ich hatte aber zwei Verletzungen, die mich von dem Gedanken wieder abgebracht haben. Das andere, was so gar nicht zum Thema Arzt passte, war, dass ich in meiner Schulzeit viele weitere Interessen hatte. Daraus resultierte, dass ich drei Mal sitzen geblieben bin. Meine Mutter ist immer wieder zu den Elternsprechtagen hingegangen: „Aber der Jochen will doch Arzt werden.“ – Ich kann mir denken, was die Lehrer dann gedacht haben. Das ging fast bis zum Schluss so. Nach dem dritten Mal sitzenbleiben, habe ich die Kurve gekriegt. Ich lag zu der Zeit selbst im Krankenhaus und da ist mir mein Wunsch wieder richtig bewusst geworden, ich habe danach Gas gegeben und die schulischen Leistungen auch erbracht. Meine Mutter habe ich dann trotzdem zu den Elternsprechtagen geschickt, als es dann besser wurde.
Und nach der Schule?
Im Anschluss habe ich den Studienplatz in Kiel bekommen. Ich wusste aber immer, ich will nicht als Arzt in einer Praxis arbeiten. Ich wollte an einer Klinik, am liebsten an einer Uni-Klinik, arbeiten, weil ich immer Interesse an Forschung hatte. Forschung habe ich schon sehr früh betrieben, auch schon im Jugendalter haben wir viele Versuche gemacht. Das war es immer, was mich wirklich interessierte.
Und das ist an einer Uni-Klinik eben gut umzusetzen, weil man dort Forschung, Lehre und Krankenversorgung hat. Dabei hängt ganz viel mit der Ausbildungsqualität zusammen, mit der man Studierende wiederum motivieren kann. Und ich sage immer, wenn diese motiviert werden, werden das auch gute Ärztinnen und Ärzte. Dass ich drei Mal sitzen geblieben bin, das lag ja nicht daran, dass ich vollkommen blöde war, sondern wohl eher daran, dass es nicht gelungen ist zu sagen „Jochen, mach mal mit!“. Und so geht man dadurch auch etwas verloren. Das gilt genauso für die Medizinstudenten, wie für alle anderen auch. Dies ist ein aktuelles Thema, denn eine ganze Reihe von Ärzten arbeiten direkt nach dem Studium überhaupt nicht mehr am Patienten.
Gibt es etwas, was Sie in Ihrer bisherigen medizinischen Laufbahn im Nachhinein anders gemacht hätten?
Ich hätte eins anders machen sollen zum damaligen Zeitpunkt: Ich hatte mir damals selbst einen Aufenthalt in den USA ermöglicht. Damals war ich junger Assistenzarzt in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, ging zu meinem Chef und sagte, dass ich die Möglichkeit hätte, zwei Jahre in die USA zu gehen. Er riet mir davon ab, weil ich, wenn ich zurückgekommen wäre, wieder bei Null angefangen hätte. Und da habe ich mich leider nach gerichtet. Private Angelegenheiten kamen auch noch dazu, so habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. Ich habe später selbst meine Mitarbeiter in andere Länder geschickt, es hat allen sehr gut getan. Und zwei Jahre USA wären für die medizinische Wissenschaft auch gut gewesen. Also das hätte ich anders gemacht.
Ansonsten bin ich auch damit, dass es nicht so kam, absolut zufrieden und dankbar für meinen weiteren Werdegang.
Gibt es noch andere Arten, wie Sie Ihr Team heute motivieren?
Erstmal ist, glaube ich, das Vorleben ganz wichtig. Die Mitarbeiter müssen merken, dass man als Chef engagiert ist und auch hinter ihnen steht. Das war immer sehr wichtig für mich. Man fängt an, man macht Fehler und wenn Mitarbeiter dann die Angst haben durch den vorgesetzten Oberarzt zum Beispiel abgestraft zu werden, indem man nicht mehr operieren darf – das ist nicht gut! Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich vor die Mitarbeiter zu stellen und ihnen dabei zu helfen, sich ihrer Stärken bewusst zu werden.
Man muss sich mit den Leuten befassen und dabei erkennt man: Der eine kann dies besonders gut und der andere das. Das unterstütze ich. So können sich die Mitarbeiter gut entwickeln. Und das ist für mich ganz wichtig. Am Schluss lebt man dadurch auch ein kleines bisschen weiter, wenn sie sich daran erinnern, wer ihnen das beigebracht hat, so wie auch ich in manchen Situationen an meinen damaligen Chef denke. Und insgesamt ist das so ein gutes Miteinander für die Mitarbeiter.
Sie sind mit 39 Jahren schon Klinik-Chef geworden. Gab es da besondere Herausforderungen, was das Alter betrifft?
Wenn man so früh Klinik-Chef wird, ist die Herausforderung noch größer, das Vertrauen der Patienten zu gewinnen. Man ist die letzte Instanz aus Sicht der Patienten und der eigenen Mitarbeiter. Und dadurch, dass ich schwerpunktmäßig in der Onkologie tätig war und auch sehr viel operiert habe, hängt das viel mit Verantwortung und Vertrauen zusammen. So ein Mitt- oder Endfünfziger strahlt natürlich mehr Kompetenz aus, die er ja auch hat, als ein 39-Jähriger. Ich kam aus einer Klinik, in der ich sehr viel operiert habe, habe viele Dienste von anderen übernommen und fühlte mich gut ausgebildet. Trotzdem: In der Chirurgie ist es so, dass mit jedem Jahr die Qualität des Chirurgen wächst. Es ist nicht immer das technische Geschick. Da gibt es auch Untersuchungen zu. Also die technischen Fähigkeiten sind oft bei einem Anfang 40-Jährigen sehr gut, aber es hängt natürlich in der Chirurgie sehr viel mit Erfahrung zusammen. Wie weit operiert man? Wann hört man auf? Das ist das echte Können in meinen Augen.
Und nun sitzt man als 39-Jähriger da und soll bei einem 69-Jährigen dessen Vertrauen gewinnen und ihn samt seiner Angehöriger durch seine vielleicht schwierigste Lebenskrise führen, auch dies ist nicht nur eine technisch-chirurgische Frage. Und was man vor allem als jüngerer Klinikdirektor bei allem Ehrgeiz berücksichtigen muss, ist bei manchen komplexen Erkrankungen mit einer sehr schwierigen chirurgischen Herausforderung die Überlegung, ob es vielleicht jemand anderen gibt, der diese spezielle Operation besser durchführen kann. Jemanden, der vielleicht genau bei dieser Behandlung mehr Erfahrung hat und dort – auch wenn man es selber machen könnte – die bessere Wahl für den Patienten wäre. Und wenn das so ist, sollte man als Arzt dann die Größe haben und den Patienten zu diesem anderen Arzt schicken, ihn gerne begleiten und mit operieren. Dadurch lernt man in der obersten Liga. Das ist besser, als die wirklichen Feinheiten nur selbst herauszufinden. Und das passiert in meinen Augen viel zu selten. Auch weil es um einen angenommenen Prestigeverlust gehen kann. Aber das ist in Wirklichkeit überhaupt kein Verlust. Patienten, die beim empfohlenen Arzt gut behandelt worden sind, kommen zu einem zurück. Und das ist das Verständnis, was bei jungen Chefärzten oft zu wenig ausgebildet ist. Dies gilt besonders für chirurgische Disziplinen im High-End-Sektor.
Gibt es Vorbilder oder Menschen, die Sie inspirieren?
Ich bin begeisterter Fußball-Fan, das ist ja klar. Ich habe meine Lieblingsspieler und -manager gehabt und habe sie auch immer noch. Mir geht es im Wesentlichen darum, dass das Typen sind. Also Günter Netzer ist ein exzellentes Beispiel. Den hab ich noch vor Augen, als er sich damals selbst eingewechselt hat und das entscheidende Tor erzielte. Das ist natürlich auch ein intelligenter Spieler. Paul Breitner war auch so ein nicht linienkonformer Mensch, von denen es heute meiner Meinung nach zu wenige gibt – nicht nur im Fußball. Beckenbauer war auch so eine Instanz – deshalb war er meiner Meinung nach auch so ein erfolgreicher Trainer. Er war immer ein großes Vorbild für seine Spieler. Oder blicken wir auf Nicki Lauda, was für eine Lebensgeschichte, und immer wieder ist er aufgestanden.
Beginnen will ich aber natürlich mit meinen Eltern: Das Vertrauen in mich zu haben, drei Mal sitzen zu bleiben und trotzdem meinen Weg zu machen – das vergesse ich natürlich niemals und gebe es an meine Kinder weiter.
Ich habe im Fernsehen ein Interview mit einem blinden Bergsteiger gesehen, der mich sehr beeindruckt hat. Mit drei begann er das Skilaufen und orientiert sich heute in den Bergen, indem er kleine Steine wirft und deren Aufprall deutet. Die Essenz war, dass er als Blinder mehr sieht als viele Menschen, die sehen können.
Prägend war natürlich auch mein Chef, aber ich will das gar nicht so stark an Personen fest machen. Ich kenne natürlich viele Menschen, die viel erreicht haben auf ihrem Gebiet, die mich inspirieren.
Wie kam Ihr Interesse an dem Thema Smart Hospital zustande?
Mich hat schon immer beschäftigt, was ich selbst in meinem Leben für Veränderungen durchlebt habe. Ich kann mich an die Zeit noch gut erinnern, als ich als Assistenzarzt Bereitschaftsdienst hatte und nur damit beschäftigt war zu überlegen, wann ich in welchem Restaurant oder im Kino oder wo auch immer erreichbar bin. Damals hatte man so einen Pieper, der funktionierte meist, aber auch nicht immer oder man hinterließ in der Klinik die entsprechenden Telefonnummern. Danach kam das Handy, das einem extrem viel Bewegungsfreiheit gab in einem gewissen Radius um die Klinik. Das war schon mal ein Fortschritt. Darauf kam die ganze Smartphone-Thematik auf und ich habe mir immer gesagt, Mensch du lebst in einer Zeit, in der ist so viel Wandel. Was war mit den Bauern, die jahrzehntelang übers Feld gelaufen sind und die einzige Änderung mal ein neues Zugpferd war. Und jetzt: Kaugummiautomaten gibt’s nicht mehr, Telefonzellen auch fast nicht mehr. Die Jugendlichen kennen den Geruch von den nassen Telefonbüchern in der Telefonzelle gar nicht. Und dann sieht man im Krankenhaus die Entwicklung der Medizin, wo vieles gleich zu bleiben schien – zwar gab es immer mal neue Geräte oder auch Medikamente, aber es bewegte sich nicht dramatisch viel. Dann zeichnete sich die Digitalisierung ab, die sich in der Radiologie sehr früh niederschlug. Und als man zu digitalen Röntgenbildern wechselte, war das ein Riesenschritt, weil man vorher als Assistent ständig damit beschäftigt war, irgendwelche Bilder zu suchen. Überall diese Röntgentüten! Dann findet man die Tüte, aber es waren falsche Bilder drin. Und wieder suchte man. So beschäftigte man Generationen von Ärzten, Krankenschwestern und -pflegern. Dies wandelte sich merkbar durch die Digitalisierung.
Dann hatte ich mehr mit administrativen Tätigkeiten zu tun, erkannte zahlreiche Blockierungen im Tagesablauf von Krankenhäusern, lernte wirtschaftliche Herausforderungen im Klinikbetrieb kennen, im Bewusstsein, dass nicht das stetige Wachsen von Patientenzahlen die letztendlich richtige Lösung sein wird. Kurz darauf wechselte ich meinen Arbeitsplatz nach Essen und lernte Herrn Prof. Dr. Forsting, den Chef der Radiologie am Essener Uni-Klinikum, kennen. Er hat seine Radiologie ausgezeichnet organisiert und dies ist bedeutsam, versorgen seine Mitarbeiter täglich mehr als tausend Patienten. Zudem leitet Professor Forsting eine wirklich kompetente Gruppe, die sich mit künstlicher Intelligenz befasst. Das heißt, die digitalen Aufnahmen von der Lunge werden maschinell ausgewertet und man kommt in einen Bereich, in dem man merkt, dass die Maschine bestimmte Diagnosen schon zuverlässiger stellen kann, als selbst ein erfahrener Radiologe. Im Moment ist beides zusammen genommen das High-End, aber die Entwicklung wird so sein, dass die Auswertung von Röntgenbildern mehr und mehr maschinell erfolgt, der Radiologe nur noch gegenzeichnen muss und sich mehr den Patienten widmen kann. Diesen Weg habe ich bei Herrn Forsting verstanden und daraus gelernt, dass solche Entwicklungen auf nahezu alle Bereiche der Medizin übertragbar sind. Die ganze Medizin entwickelt sich dramatisch anders. Die Untersuchungsdaten werden zusammengefasst und maschinell ausgewertet.
So gibt es beispielsweise IBM Watson. Das ist ein kognitives Computersystem, welches eben solche Analysen machen und auch Krankengeschichten analysieren und Diagnosen schneller finden kann. Das ist für eine normale Klinik nicht bezahlbar. Ich glaube auch nicht, dass dies der einzige richtige Weg ist. Wir sind zwischenzeitlich Partnerschaften mit kleinen und großen Unternehmen eingetreten, all das hat ganz viel mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz zu tun.
Was ist das Ziel vom Smart Hospital?
Wenn man sich auf den Weg zum Smart Hospital macht, geht es darum, bessere Medizin anzubieten und die Patienten und Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Es kann nicht sein, dass ein Patient in einer Phase, in der es ihm nicht gut geht und er drei Wochen lang im Krankenhaus liegt, einen schlechteren Service genießt, als in einem 3-Sterne-Hotel auf Mallorca. Und da beginnt man bei den Serviceleistungen, den Hotellerieleistungen. Das ist nichts, was man neu erfinden muss. Das ist heute direkt übertragbar. Das ist der eine Schritt, und der andere ist, nicht nur über Patienten zu reden, sondern sie miteinzubeziehen. Dafür haben wir ein Institut für PatientenErleben gegründet. Das ist einzigartig in Deutschland. Patienten sagen uns – digital unterstützt – was bei ihrem Aufenthalt gut lief, wo es Mängel gab und was wir wie besser machen können.
Diagnostik wird mehr und mehr digital zusammengeführt. Es gibt heute schon Anamnese- und Diagnostikverfahren als Apps, die man herunterladen kann, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, die Diagnosen bei seltenen Erkrankungen dramatisch schneller finden werden, als es herkömmlich der Fall ist. Auch da tut sich viel. Dann kann man lange drüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Es ist so und es wird auch nicht mehr zurückgedreht, es wird sich nur noch schneller entwickeln.
Dann kommt der andere Punkt der individualisierten Therapie, wo man bestimmte Chemo- und/oder Immuntherapieverfahren quasi auf die spezielle genetische Analyse der individuellen Tumorerkrankung ausrichtet. Früher haben bestimmte Medikamente bei dem einem Patienten gewirkt und bei dem anderen nicht. Heute weiß man aber, warum das so ist. Und man kann manchmal auf eine solche Therapie verzichten, dem Patienten Belastungen ersparen und andere Behandlungsverfahren anbieten. Dies ist auch deshalb wichtig, weil solch eine Therapie eine halbe Million Euro kosten kann und die verfügbaren Ressourcen natürlich die Patienten bekommen sollen, bei denen sie auch möglichst wirkt. Und diese Form der individualisierten oder auch personalisierten Medizin ist mehr und mehr verfügbar, dieser Behandlungsansatz wird immer bedeutsamer.
Also: Diagnostik verändert sich, Therapie verändert sich und Hotellerieservice muss implementiert werden. Das ist der Bereich mit dem Fokus auf den Patienten.
Gibt es noch einen anderen Bereich?
Der andere Bereich der Digitalisierung ist die Optimierung der administrativen Arbeiten, zum Beispiel für Krankenpflege. Die Mitarbeiter sind beschäftigt mit einer Vielzahl von Dokumentationen und mit Suchvorgängen, etc. Wir haben das Ausrollen der elektronischen Patientenakte nahezu abgeschlossen und zwar im gesamten Klinikum.
Vorher hatte jede Fachabteilung eine eigene Akte und ein eigenes Aktenführungssystem. Alle suchen, alle tragen was ein. Vieles wird doppelt erfasst. Die alte Anamnese wird nicht eingesehen. Der neue Arzt vergisst eine der drei vorhandenen Allergien. Es ist doch vollkommen klar, dass man eine elektronisch basierte Anamnese haben muss, die dann lebenslang ergänzt wird und immer abrufbar ist. Es kann nicht angehen, dass man jedes Mal überlegt, was bekam und bekommt der Patient für Medikamente? Hat Frau Schulze vergessen, den Beipackzettel mitzunehmen? Das muss dokumentiert sein! Und dann kann man sich heute auch digitalisiert Warnsignale geben lassen, wenn man bestimmte Medikamente kombinieren will. Dann kann der Arzt entscheiden, ob er die Gabe des bestimmten Medikaments trotz der Warnung für wichtig hält. Diese Vorgänge kann man optimieren, um dem Patienten viel mehr Sicherheit zu geben. Also Digitalisierung als Weg, um auch das Personal wieder näher zum Patienten zu bringen, statt nur mit irgendwelchen administrativen Aufgaben zu belasten. Auch das ist dann Smart Hospital.
Auch das Thema Erreichbarkeit ist bundesweit ein großes Thema. Wir an der Universitätsmedizin in Essen richten ein Service- und Informationscenter ein. Das wird für uns von einem der größten Call-Center-Anbieter weltweit eingerichtet. Und ich weiß, dass uns das einen enormen Schritt nach vorne bringt.
Heutige Technologien als Unterstützung für die arbeitenden Personen zu sehen, ergibt einen Sinn und diese auch zu nutzen, ist unser Ziel. Daran arbeiten wir sehr intensiv.
Was gefällt Ihnen am Ruhrgebiet?
Ich mache morgens oft auf der Margarethenhöhe beim Bäcker einen Boxenstopp, wo ich zwei Essener Urgesteine kennengelernt habe. Beide erzählen mir viele Geschichten aus Essen, ich lerne diese Stadt Tag um Tag besser kennen, habe größten Respekt vor den Leistungen der hier lebenden Menschen. Wenn man nicht von hier kommt, hat man doch keine Ahnung, was Essen für eine spannende Stadt ist.
Mich freut auch die Menschendichte hier. Wenn man aus einem spärlich besiedelten Gebiet kommt, ist es eine Freude zu sehen, wie viele Menschen hier leben. Kulturell ist unglaublich viel los. Schon in Essen, aber auch in den anderen Städten der Region. Das Ruhrgebiet hat eben sehr viel zu bieten. Ruhrgebiet ist auch Kulturgebiet. Die Leute gefallen mir. Die Menschen sind sehr offen.
Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, dem ich erzählte, dass mein Vater früher viel im Ruhrgebiet unterwegs war und wenn er nach Hause kam sagte er immer „Mein weißes Oberhemd, das ist so …“ und mein Gegenüber beendete den Satz „Ja also bei uns sagt man dreckig!“ Und das ist eben frei heraus und klar rübergekommen. Das gefällt meiner Frau und mir sehr. Nicht schön formuliert „mit Staub bedeckt“ – nein, „dreckig“. Dieses klare sagen, was man denkt, das kann ich auch gut. Und da fühle ich mich auch aufgehobener, als wenn man sich Gedanken über die Formulierungen machen muss und immer hinten rumredet.
Ich bin sportbegeistert, man kann hier viel Sport sehen. Zwischen mehreren Bundeligavereinen kann man sich entscheiden – und diese in weniger als einer Stunde Fahrt erreichen. Nur muss Essen mal wieder hochkommen. Ich habe mich direkt engagiert – RWE, TUSEM. Bei aller Enttäuschung aus den vergangenen Jahren, wir müssen mehr Sponsorenbereitschaft wecken. Kulturell hat Essen einen Sprung gemacht, was Musik und Theater betrifft, Sport aber ist auch Kultur und zudem wirtschaftliches Potenzial. Nun stelle man sich nur mal vor, RWE würde in der zweiten Liga spielen, nicht auszudenken. Ohne Geld kommt eine Fußballmannschaft nicht mehr hoch.
Wo haben Sie Fußball gespielt?
Ich habe beim TSB Flensburg gespielt, bis in die Landesauswahl, aber wenn man einen Bruder hat, der Nationaltorwart im Handball war, dann ist das schon was anderes. Er hatte sicher viel mehr Talent als ich. Im Studium habe ich mir viel Handball angeschaut. Das war auch mein erster Essen-Kontakt, als der TSB mal gegen TUSEM in Hamburg gespielt hat.
Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden?
Ja. Ich habe ein sehr gutes und auch interessantes Leben. Ich bin wirklich froh über meinen beruflichen Werdegang und darüber, dass mein Beruf mir immer viel Freude bereitet hat. Dies ist nicht bei vielen Menschen so. Ebenso bin sehr dankbar für meine Familie.
Wenn das Leben ein Comic wäre, welche Figur wären Sie dann?
Ich wäre Schroeder von den Peanuts. Als ich im praktischen Jahr des Medizinstudiums war, habe ich die Aufgabe bekommen, endlos lange Passagen für die Krankenakte zu schreiben. Und die musste ich mit der Schreibmaschine schreiben, weil man die Handschriften oftmals nicht lesen konnte. Und ich saß dann da immer mit meiner Schreibmaschine, schließlich meinte ein Oberarzt ich säße am Tisch wie Schroeder am Klavier, so war dort ein Spitzname geboren.

Infos zum Smart Hospital: www.medical-influencer.de
Das Interview führten wir im August 2018.
Das Interview bietet einen Einblick in die Gedanken, Meinungen und Perspektiven der interviewten Person zu diesem bestimmten Zeitpunkt, reflektiert aber nicht zwangsläufig ihre gesamte Persönlichkeit oder ihre langfristigen Ansichten. Das Leben verändert sich stetig. Unsere Überzeugungen, Werte und Erfahrungen entwickeln sich im Laufe der Zeit weiter. Was heute wahr oder relevant ist, kann in der Zukunft anders aussehen. Dieses Interview ist als Momentaufnahme zu verstehen.